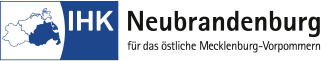Begriffe rund um nachhaltiges Wirtschaften

Nach zahlreichen und facettenreichen Begriffsdefinitionen wird heutzutage unter Nachhaltigkeit ein Prinzip verstanden, nach dem „nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Ursprünglich handelt es sich um ein forstwirtschaftliches Prinzip, wonach „nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann“ (Duden).
Unter einer nachhaltigen Entwicklung wird jene Entwicklung verstanden, die „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Brundtland-Definition).
Das Drei-Säulen-Modell beinhaltet, dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann. Ökologie, Wirtschaft und Soziales sind die drei Säulen des Modells – und bedingen einander.
Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Konzept, nach dem die Unternehmen auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Tätigkeit integrieren. Dabei ist von der ganzheitlichen Unternehmensverantwortung die Rede: der gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen.
Im nachfolgenden Verzeichnis haben wir einige Begriffe rund um das Thema nachhaltiges Wirtschaften für Sie zusammengestellt und erklärt.
Marktwirtschaftliches Instrument, mit dem die Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO₂) gesenkt werden. Dabei wird politisch entschieden, wie viele Treibhausgase von allen Teilnehmenden zusammen ausgeschieden werden dürfen. Eine Höchstgrenze für die einzelnen Teilnehmer gibt es nicht. Jedes Unternehmen, das Treibhausgase emittiert, zahlt für jede Tonne CO₂ einen Preis, indem es dafür Zertifikate erwirbt. Der Preis für diese Zertifikate entsteht durch Handel ("Trade") am Markt. Je weniger Ausstoß von Treibhausgasen erlaubt ist, desto knapper und damit teurer werden die Zertifikate.
Ergebnis einer Emissionsberechnung, das die Menge von Treibhausgasen angibt, die durch Aktivitäten eines Unternehmens oder einer Person, bspw. durch den Produktionsprozess oder die Erbringung einer Dienstleistung freigesetzt werden.
Der Begriff CO₂-neutral beschreibt ein Unternehmen, dessen Netto-CO₂-Emissionen in Summe gleich null sind. Dieser Prozess erfordert die Messung der gesamten CO₂-Emissionen sowie aktive Schritte, den Emissionshaushalt des entsprechenden Unternehmens zu verringern. Für die restlichen CO₂-Emissionen, die das Unternehmen nicht verringern kann, gibt es die Möglichkeit des Ankaufs von CO₂-Zertifikaten. Diese Zertifikate tragen zur Finanzierung von CO₂-verringernden Projekten bei.
Dieses Prinzip basiert auf geschlossenen Kreisläufen, die keine Abfälle erzeugen und wertvolle Rohstoffe für heutige und zukünftige Generationen erhalten. Gemäß dem Cradle-to-Cradle Ansatz sollen friedliche Koexistenz von Wirtschaft und Natur ermöglicht werden. Der Gegensatz zu Cradle-to-Cradle („von Wiege zu Wiege“) wird oft Cradle-to-Grave genannt, wobei die wertvollen Materialien im Müll landen.
Dekarbonisierung beschreibt den Prozess der Reduktion der durch wirtschaftliche Aktivitäten produzierten Kohlendioxidemissionen durch den Einsatz kohlenstoffarmer Energiequellen, wodurch ein geringerer Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre erreicht wird.
Branchenübergreifender Transparenzstandard, der den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt und einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung bietet.
Das GHG Protokoll (Greenhouse Gas Protocol) unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen Emissionskategorien, sogenannten Scopes. Unter Scope 1 fallen alle direkten Emissionen, also solche die aus Emissionsquellen innerhalb der festgelegten Systemgrenzen stammen, zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens entstehen. Scope 2- und Scope 3-Emissionen sind indirekt. Während Scope 2-Emissionen bei der Erzeugung von Energie, die von außerhalb bezogen wird, entstehen, konzentriert sich Scope 3 auf Emissionen, die durch die Unternehmenstätigkeit verursacht werden, jedoch nicht unter der unmittelbaren Kontrolle des Unternehmens stehen. Dazu zählen alle Emissionen in beide Richtungen der Wertschöpfungskette, also alle Vorgänge von der Gewinnung, über den Transport, bis hin zur Abfallwirtschaft.
Die ESG-Kriterien umfassen die drei nachhaltigkeitsrelevanten Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Durch die Aspekte Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G) werden die Unternehmensleistungen im Bereich Nachhaltigkeit gemessen.
Zentraler Bestandteil des EU-Aktionsplans für ein nachhaltiges Finanzwesen. Ziel des Aktionsplans ist es, die Finanzströme in nachhaltigere Aktivitäten umzulenken, um so die Transformation der Wirtschaft finanzieren zu können. Mit einem einheitlichen Klassifikationssystem soll die Taxonomie genau definieren, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig einzustufen und welche Bedingungen dafür zu erfüllen sind.
Zentraler Bestandteil der EU-Klimapolitik, der die europäische Wirtschaft und Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit führen soll. Nach der Vereinbarung der Mitgliedsstaaten soll die EU bis 2050 klimaneutral werden. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 gesunken sein.
Strategien, deren Zusammenspiel eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht.
Effizienz steht für eine Steigerung der Material-, Rostoff- und Energieeffizienz, die primär mit der Ressourcenproduktivität durch technische Neuerungen verbunden ist. Beispiele: Nutzung effizienter Geräte, Energieeffizienz in der Produktion und im Büro.
Suffizienz steht für das Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch und ist mit der Suche nach dem rechten Maß in Bezug auf die Änderung des Lebensstils und Konsumverhaltens einschl. der Selbstbegrenzung verbunden. Beispiele: Produktlanglebigkeit, Werkzeugverleih oder geringerer PKW-Einsatz.
Konsistenz öffnet neue Pfade der Technik- und Produktentwicklung, die auf einer qualitativen Umgestaltung gemäß der Umweltverträglichkeit und Innovationsprozessen beruht. Beispiele: Recyclinginfrastruktur im Betrieb, Nutzung der ökologischen Landwirtschaft oder Dekarbonisierung der Geschäftsprozesse bspw. durch erneuerbare Energien oder Wasserstoff.
Seit 1956 haben die IHKs die gesetzliche Aufgabe, für Wahrung von Anstand und Sitte der Ehrbaren Kaufleute, einschließlich deren gesellschaftlicher Verantwortung, zu wirken. Daher nimmt das Leitbild der Ehrbaren Kaufleute für die IHK-Organisation bei der Förderung des verantwortungsvollen, nachhaltigen Wirtschaftens eine wichtige Rolle ein.
Fahrplan, der den Umgang mit relevanten Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens beschreibt. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird in allen Bereichen systematisch in Prozesse und Maßnahmen integriert sowie mit Zielen, Zeitrahmen und Indikatoren hinterlegt.
Verwertungsverfahren, bei dem ein genutztes Produkt so aufbereitet wird, dass es einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Somit werden die Wertstoffe in den Wirtschaftskreislauf integriert und zur Herstellung anderer Produkte genutzt.
Die SDG der Vereinten Nationen definieren ökologische, wirtschaftliche, soziale und ethische Ziele für eine weltweit nachhaltige Entwicklung. Die SDG, auch bekannt als Agenda 2030, sind 17 von der UN gesetzte politische Ziele, die darauf abzielen, nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben. Die Ziele sind unter anderem Armut reduzieren, Gleichberechtigung herstellen, nachhaltigen Konsum fördern, klimafreundliche Aktivitäten vorantreiben und Ungleichheit reduzieren. Dabei berücksichtigen die SDGs alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ESG): Soziales, Umwelt und Wirtschaft.
Die CSRD ist eine Überarbeitung der Richtlinie über die nicht finanzielle Berichterstattung (NFRD) und ersetzt diese im Wesentlichen. Sie legt eine spezifische und detailliertere Struktur und Inhalte fest, die alle großen Unternehmen sowie kleine und mittlere kapitalmarktorientierte Unternehmen offenlegen müssen. Außerdem wird sie die Angleichung zwischen der Taxonomie und der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in Bezug auf die Definition, Messung und Offenlegung von ESG-Daten sicherstellen. Die erweiterte Nachhaltigkeitsberichterstattung wird ab dem Geschäftsjahr 2024 für die schon bisher NFRD-pflichtigen Unternehmen gelten und ab dem Geschäftsjahr 2025 gestaffelt für die CSRD-pflichtigen Unternehmen.
Austausch mit Anspruchsgruppen des Unternehmens über dessen Nachhaltigkeitsstrategie, mittlerweile ein wichtiges Instrument des Nachhaltigkeitsmanagements. Die unterschiedlichen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitende, Kund/-innen, Wettbewerber usw.) haben einen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit oder sind von Unternehmensaktivitäten betroffen.
Eine Form der Wiederverwertung, wobei Gegenstände oder Rohstoffe nach ihrem eigentlichen Produktlebenszyklus kreativ zweckentfremdet und in ihrer ursprünglichen Form zu neuwertigen Produkten umgewandelt werden. Beispiele: Taschen aus LKW-Planen, Röcke aus alten Anzughosen, Gartenmöbel aus gebrauchten Transportpaletten.
Zielsetzung, den globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Mit dem Übereinkommen von Paris verpflichteten sich die Staaten, weitreichende Anstrengungen zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels zu unternehmen.