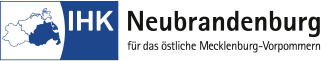CSRD: Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte

2023 ist die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU in Kraft getreten. Ziel der Richtlinie ist es, dass Unternehmen auf Basis umfassender Standards vergleichbare, detaillierte und verlässliche Nachhaltigkeitsinformationen veröffentlichen. Die CSRD-Richtlinie, die die sog. CSR-Richtlinie ablöst, wird innerhalb von 18 Monaten von den Nationalstaaten umgesetzt. Nach den neuen verbindlichen, verpflichtenden Standards muss künftig eine deutlich höhere Zahl von Unternehmen deutlich mehr über Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten.
Es werden weitaus mehr Unternehmen als bisher zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. So gilt die Berichtspflicht nicht mehr nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern für alle großen Unternehmen, die zwei der drei folgenden Größenkriterien erfüllen:
- Bilanzsumme von mindestens 25 Millionen Euro,
- Nettoumsatzerlöse von mindestens 50 Millionen Euro,
- mindestens 250 Beschäftigte.
Zusätzlich werden kleine und mittlere Unternehmen ab zehn Mitarbeitern zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, sofern eine Kapitalmarktorientierung vorliegt.
Es wird geschätzt, dass sich so die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland von 500 auf 15.000. erhöhen wird. Hinzu kommen mittelbar betroffene Zulieferunternehmen.
Die deutschen Industrie- und Handelskammern warnen vor Überlastungen der Unternehmen und plädieren für praxistaugliche, verhältnismäßige und rechtssichere Regelungen bei der Umsetzung in deutsches Recht.
Die Anwendung der neuen Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist in drei Stufen vorgesehen:
- ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen, die bereits der CSR-Richtlinie unterliegen;
- ab dem 1. Januar 2025 für große Unternehmen, die derzeit nicht der CSR-Richtlinie unterliegen. Als groß gelten Unternehmen, die zwei der drei folgenden Größenkriterien erfüllen: 1) Bilanzsumme von mindestens 25 Millionen Euro, 2) Nettoumsatzerlöse von mindestens 50 Millionen Euro, 3) mindestens 250 Beschäftigte;
- ab dem 1. Januar 2026 für börsennotierte KMU sowie für kleine und nicht komplexe Kreditinstitute und firmeneigene Versicherungsunternehmen.
Kapitalmarktorientierte KMU können für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2028 beginnen, beschließen, auf einen Nachhaltigkeitsbericht zu verzichten. Sie müssen in ihrem Lagebericht aber angeben, warum die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vorgelegt wurde.
Grundsätzlich müssen alle Informationen zu den Auswirkungen des Unternehmens auf die Nachhaltigkeitsaspekte (sog. Wesentlichkeit der Auswirkungen) sowie zu den Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf das Unternehmen (sog. finanzielle Wesentlichkeit) offengelegt werden. Somit wird in der CSRD das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit manifestiert, das zur Ermittlung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens dienen soll.
Zusätzlich müssen berichtspflichtige Unternehmen die grünen Finanzkennzahlen der Taxonomie-Verordnung (EU 2020/852) beachten und darstellen, wie und in welchem Umfang die Tätigkeiten des Unternehmens sowohl in Bezug auf Umsatz als auch Investitions- und Betriebsausgaben mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die im Sinne der Verordnung als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten einzustufen sind.
Berichtsinhalte und -struktur werden mittels verbindlicher EU-Nachhaltigkeitsstandards ("European Sustainability Reporting Standards", ESRS) definiert. Die Standards werden von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelt. Für kapitalmarktorientierte kleine und mittlere Unternehmen soll es einen separaten Standard geben. Ein erster Entwurf soll im Sommer 2023 zur Konsultation gestellt werden.
Die EU-Kommission hat 12 Berichtsstandards veröffentlicht. Zwei davon betreffen themenübergreifende Angaben und Prinzipien und zehn beziehen sich auf die klassische dreigliedrige Nachhaltigkeitsberichterstattung (Environment, Social und Governance /ESG). Die zehn themenspezifischen ESRS enthalten eine Vielzahl an Berichtsanforderungen, die durch Anwendungsleitlinien präzisiert und erweitert werden.
Übergreifende Standards
ESRS 1 Allgemeine Anforderungen
ESRS 2. Allgemeine Angaben
Themenspezifische Standards
Umwelt
ESRS E1 Klimawandel
ESRS E2 Umweltverschmutzung
ESRS E3 Wasser- und Meeresressourcen
ESRS E4 Biologische Vielfalt und Ökosysteme
ESRS E5 Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft
Soziales
ESRS S1 Eigene Belegschaft
ESRS S2 Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette
ESRS S3 Betroffene Gemeinschaften
ESRS S4 Verbraucher und Endnutzer
Governance
ESRS G1 Unternehmenspolitik
Hier finden Sie die Standards in deutscher Sprache.
Berichtspflichtige Unternehmen werden verpflichtet, Nachhaltigkeitsinformationen für das vorliegende Geschäftsjahr im Lagebericht darzustellen und mit einem digitalen Tagging zu versehen. Der Bericht ist in dem europäischen einheitlichen elektronischen Berichtsformat, also dem European Single Electronic Format (ESEF), zu veröffentlichen. Die Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsbericht gesondert zu veröffentlichen, wird nicht mehr bestehen.
Der Nachhaltigkeitsbericht als Teil des Lageberichts muss extern geprüft werden. Zunächst ist die Prüfung "zur Erlangung begrenzter Sicherheit" und später "zur Erlangung hinreichender Sicherheit" durchzuführen.
Das Management wird aktiv und nachweislich die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung tragen. Der Bilanzeid, der sich bislang nur auf die Finanzberichterstattung bezieht, soll so auf den Nachhaltigkeitsbericht ausgeweitet werden. Weiterhin ist der Aufsichtsrat verantwortlich für die Überwachung der Berichterstattung.
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist insbesondere für Unternehmen ein Thema, die selbst oder deren Kunden der CSRD unterliegen oder in den Anwendungskreis des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes fallen.
Doch nicht nur der Gesetzgeber verlangt zunehmend von Unternehmen die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen. Auch Investoren, Banken, Kunden, Geschäftspartner und andere Stakeholder verlangen mehr Transparenz von Unternehmen über die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft.
Ein Nachhaltigkeitsbericht bietet daher vielseitige Chancen:
- Mit Hilfe des Nachhaltigkeitsberichts kann Nachhaltigkeit strukturiert im Unternehmen verankert werden;
- Nachhaltigkeit wirkt sich vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung von Sustainable Finance positiv auf Kapitalbeschaffung, Kostenstrukturen und Absatzvolumen aus;
- Der langfristige Unternehmenserfolg und -wert lässt sich nicht mehr einzig aus der Finanzsituation beurteilen, sondern muss insbesondere die Chancen und Risiken eines Unternehmens im Zusammenspiel mit seinem Umfeld reflektieren. So stehen Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange in enger Wechselwirkung mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Für Erstanwender finden sich ausführliche Leitlinien zur Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts auf den Websites der entsprechenden Berichtsstandards. So stellt der Deutsche Nachhaltigkeitskodex beispielsweise in der Orientierungshilfe für Einsteiger die zentralen Schritte zur erfolgreichen Nachhaltigkeitsberichterstattung nach DNK vor. Auf den Seiten der Global Reporting Initiative finden Sie ein eigenes Ressource Center, das die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Unternehmen unterstützen soll.
Die IHK-Organisation hat in Zusammenarbeit mit Value Balancing Alliance und Deloitte den Leitfaden "In fünf Schritten zum Erfolg: Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU" veröffentlicht, der die geplanten Änderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Europäischen Kommission erläutert und die Schritte hin zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung vorstellt.
Die Handlungshilfe „10 Schritte zur CSRD“ vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, die in Kooperation mit dem BIHK e. V. entstanden ist, gibt Orientierung, nützliche Tipps und Hinweise auf kostenlose und hilfreiche Tools.
Entwurf: Freiwilliger Nachhaltigkeits-Standard für KMU
Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden sich künftig stärker mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzen (müssen). Zum einen müssen CSRD-pflichtige Unternehmen die Auswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette bewerten und werden daher Daten ihrer Lieferanten einfordern. Zum andern werden Banken Nachhaltigkeitsaspekte bei der Vergabe von Krediten und Fördermitteln berücksichtigen. Um KMU zu entlasten und Datenanforderungen zu vereinheitlichen, hat die EU im Januar 2024 einen ersten Entwurf zum "Voluntary SME-Standard" (VSME, nur englisch) vorgelegt. Das freiwillige Instrument soll KMU in die Lage versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele und -projekte einfacher zu dokumentieren. Eine inoffizielle Übersetzung der Datenpunkte (s. Download-Bereich rechts) ist im Rahmen eines Pilot-Projekts zwischen DHBW, DIHK und DRSC entstanden.
Nicht kapitalmarktorientierte kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sind von der gesetzlichen Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, zwar nicht erfasst. Sie werden in vielen Fällen jedoch von ihren Geschäftspartnern und Kunden aufgefordert, Nachhaltigkeitsinformationen bereitzustellen. Teilweise erhalten sie von ihren Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Fragebögen mit nicht deckungsgleichen Datenanforderungen.
Die IHK-Organisation hat in ihren Stellungnahmen und Positionspapieren in den vergangenen Jahren die aus überwiegender Sicht unverhältnismäßigen Anforderungen an die Berichterstattung sowohl der direkt, aber auch der mittelbar betroffenen Unternehmen aufgenommen. Angesichts der Rückmeldungen forderte sie, die Regelungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (ESRS) zu reduzieren beziehungsweise verhältnismäßig auszugestalten (vergleiche unter anderem das DIHK-Positionspapier zum Thema Sustainable Finance in den Europapolitischen Positionen 2023). Nachbesserungen sind erfolgt, allerdings in nicht ausreichender Weise.
Ein europaweiter Standard könnte – bei entsprechender Akzeptanz der Geschäftspartner – die Chance bieten, die mittelbare Belastung der nicht direkt berichtspflichtigen KMU einzudämmen. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) mit der Erstellung eines solchen Standards beauftragt. Der erste Entwurf wurde am 22. Januar 2024 veröffentlicht.
Der VSME soll nicht verbindlich sein, sondern eine "freiwillige" Alternative zu den individuellen Fragebögen bieten, die viele KMU von berichtspflichtigen Unternehmen erhalten. Wichtig ist nun zu prüfen, ob der VSME-Entwurf einerseits den Informationsbedarf der berichtspflichtigen Geschäftspartner und Finanzinstitute erfüllen kann und andererseits die vom VSME geforderten Informationen den nicht berichtspflichtigen KMU auch vorliegen. Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, könnte ein künftiger VSME-Standard dazu beitragen, die mittelbare Belastung der KMU zu reduzieren.
Der Bericht gemäß VSME soll jährlich erstellt und unter bestimmten Voraussetzungen als separater Abschnitt im (Konzern-)Lagebericht aufgenommen werden können. Ansonsten ist eine separate Veröffentlichung vorgesehen. Er soll zur gleichen Zeit wie der Jahres-/Konzernabschluss beziehungsweise die Finanzberichterstattung zur Verfügung stehen, soweit diese zu erstellen sind. Bestimmte sensible Informationen darf das Unternehmen weglassen. Ab dem zweiten Jahr sollen Vergleichszahlen zum Vorjahr in den Bericht aufgenommen werden.
Der VSME-Entwurf bietet drei Module an (für das individuelle Unternehmen oder auf konsolidierter Basis): das Basic Module, das Narrative-Policies, Actions and Targets (PAT) Module sowie das Business Partners Module. Sie enthalten Nachhaltigkeitsinformationen zu umweltbezogenen und sozialen Themen sowie zur Unternehmenspolitik.
Ein Unternehmen könnte das Basis Modul allein, das PAT-Modul zusammen mit dem Basis Modul, das Business Partner Modul zusammen mit dem Basis Modul oder alle drei Module gemeinsam anwenden. Eine Übersicht über die Datenpunkte in deutscher Sprache gibt eine inoffizielle Übersetzung, die im Rahmen eines Pilot-Projekts zwischen DHBW, DIHK und DRSC entstanden ist (s. Download-Bereich rechts).
Mindestanforderung für alle KMUs bei Anwendung des Standards.
Das Basis-Modul (Basic Module) richtet sich laut VSME-Entwurf an Kleinstunternehmen im Sinne der Rechnungslegungsrichtlinie und enthält die geringsten Anforderungen. Eine Wesentlichkeitsanalyse ist nicht erforderlich. Die inhaltlichen Angaben des Basis-Moduls gliedern sich auf in die Ziffern B 1 bis B 12 und enthalten insgesamt circa 30 Datenpunkte. Die Angaben nach B 1 und B 2 sind grundsätzlich verpflichtend, die Angaben aus B 3 bis B 12, wenn sie für die Kleinstunternehmen zutreffen. Ergänzend steht ein erläuternder Leitfaden (Seite 20ff. des Standardentwurfs) zur Verfügung, der Berechnungsbeispiele, Formeln et cetera enthält.
Die Angaben in B 1 und B 2 fordern Informationen, welches Modul vom Unternehmen angewendet wird, ob es auf konsolidierter Ebene oder individueller Ebene genutzt wird und die Nennung der Tochtergesellschaften. Zudem soll das Unternehmen kurz spezifische Praktiken beschreiben, die auf eine Transition zu einer nachhaltigeren Wirtschaft abzielen, falls diese vorhanden sind.
Zudem sind der Gesamtenergieverbrauch aufgegliedert nach Energieträgern und die Brutto-THG Emissionen anzugeben. Eine Liste inklusive der Menge an Schadstoffen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften gemeldet werden müssen (oder Verweis auf öffentlich zugängliche Informationen (zum Beispiel Homepage)), Wasserverbrauch und -entnahme, Angaben zum Abfall- und Ressourcenmanagement et cetera sind nach dem aktuellen Entwurf ebenfalls gefordert. Soziale Aspekte werden unter anderem mit der Anzahl der Mitarbeiter aufgegliedert nach Vertragsarten, Geschlecht, Ländern sowie zu den Löhnen verlangt.
Das Unternehmen soll auch darüberhinausgehende Informationen qualitativer und quantitativer Art den Datenpunkten von B 3 – B 13 beifügen können. Möglich wären auch Ergänzungen aus dem PAT- und/oder Business Partner Modul.
Für alle KMUs, die sich bereits mit Nachhaltigkeits-Leitlinien, -Strategien, -Zielen und -Maßnahmen auseinandersetzen (wollen).
Das Narrative-Policies, Actions and Targets Module (PAT-Modul) ergänzt das Basis Modul und ist für Unternehmen gedacht, die bereits formalisierte Unternehmensleitlinien, Maßnahmen und Ziele in Bezug auf die Nachhaltigkeit definiert haben (aber nicht berichtspflichtig im Sinne der CSRD) Es bedarf einer Wesentlichkeitsanalyse nach dem VSME-Standardentwurf, um die Offenlegung der wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen sicherzustellen; dabei kann Appendix B des VSME-Entwurfs als Leitlinie für das Unternehmen genutzt werden.
Die Erläuterungen zu Unternehmensleitlinien, Maßnahmen und Ziele (= Policies, Actions and Targets (PAT)), sind in N 1 bis N 5 mit circa 25 Be-/Umschreibungen der Leitlinien, Maßnahmen und Ziele vorgesehen. So soll das Unternehmen die wichtigsten Elemente seiner Strategie und seines Geschäftsmodells sowie die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte, die sich aus seiner Wesentlichkeitsanalyse ergeben haben, angeben.
Es soll auch erläutern, wie es mit den für ihn wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten umgeht und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sowie die damit verbundenen möglichen Auswirkungen in Bezug auf finanzielle Risiken und sofern einschlägig, in Bezug auf die Chancen.
Auch sollen Informationen zu sozialen Aspekten und Informationen über die Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie zur Governance und die Verantwortlichkeiten im Unternehmen gegeben werden. Zudem sollen neben den Angaben von B 1 und B 2 die in B 3 bis B 12 enthaltenen Offenlegungsanforderungen erfüllt werden, soweit sie für das Unternehmen von Bedeutung sind.
Für alle KMUs, die von Kunden zur Datenlieferung aufgefordert werden.
Das sogenannte Business-Partner-Modul (BP-Modul) soll in Verbindung mit dem Basis Modul aber auch mit dem Basis- und PAT-Modul genutzt werden können. Es enthält weitere Daten, über die Offenlegungen in B 1 bis B 12 hinausgehend, die von Kreditgebern, Investoren, Geschäftspartnern des Unternehmens benötigt werden.
Es bedarf einer Wesentlichkeitsanalyse nach dem VSME-Standardentwurf, um die Offenlegung der wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen sicherzustellen; dabei kann Appendix B des VSME-Entwurfs als Leitlinie für das Unternehmen genutzt werden. Das Unternehmen soll entsprechend BP 1 bis BP 11 circa 35 Datenpunkte und Beschreibungen angeben. Beispielsweise, ob das Unternehmen in bestimmten Risikosektoren tätig ist, die Geschlechterdiversität im Leitungs- beziehungsweise Kontrollorgan und wenn es Emissionsreduktionsziele für sich festgelegt hat, sollen diese auch aufgenommen werden.
Es soll auch Informationen zu seinem Übergangsplan für die Minderung des Klimawandels und die erwarteten finanziellen Auswirkungen angeben, die sich aus physischen Risiken des Klimawandels auf das Unternehmen ergeben können. Gefährliche und/oder radioaktive Abfälle sollen ebenfalls in den Bericht aufgenommen werden.
Zudem soll angegeben werden, ob die internen Leitlinien des Unternehmens mit den internationalen Leitlinien, wie den UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechten, vereinbar sind, das Unternehmen Prozesse eingerichtet hat, die die Einhaltung unter anderem der OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen sichern und ob gegebenenfalls Verstöße im Zusammenhang mit der eigenen Belegschaft vorliegen.
Auch sind Angaben zu Anspruch und Nutzung familienbezogener Freistellungen und zur Anzahl der Auszubildenden vorzunehmen.
Ein Leitfaden steht für die Angabepflichten von BP 1 bis B 11 auf Seite 36ff. zur Verfügung.
Als Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dient die Wesentlichkeitsanalyse – ein Prozess, in dem die für ein Unternehmen relevanten Nachhaltigkeitsthemen identifiziert und bewertet werden. Die Anforderungen an die Wesentlichkeitsanalyse für das PAT-Modul und das Business Partner Modul sind im Entwurf des VSME umschrieben und entsprechen im Prinziop der Wesentlichkeitsanalyse für CSRD-pflichtige Unternehmen. Grundsätzlich soll das Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse sowie eine Liste der für das Unternehmen bedeutsamen Themen in den Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden.
Bei der Wesentlichkeitsanalyse soll das Unternehmen die im Appendix B enthaltene Liste der Nachhaltigkeitsthemen als Leitlinie verwenden können. Wie bei den ESRS gilt, dass eine sogenannte doppelte Wesentlichkeit zu ermitteln ist: die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Menschen (impact materiality) und die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf das Unternehmen (financial materiality). Dabei sollen grundsätzlich aktuelle und potenzielle Auswirkungen, kurz-, mittel- und langfristig, einbezogen werden, wie auch die Wertschöpfungskette. Einzelheiten zur Wesentlichkeitsanalyse gibt es in Ziffer 42ff. des VSME sowie Ziffer 59 (zum PAT-Modul in N 2) und Ziffer 68 (zum BP-Modul).
Der Entwurf des VSME (englisch) steht bis zum 21. Mai 2024 zur öffentlichen Konsultation der EFRAG. Im Rahmen der Konsultation sind die Einschätzungen und Bewertungen der KMU, die den VSME anwenden können, ebenso von Bedeutung wie die der großen Unternehmen und Geschäftspartner, die Daten der KMU anfordern.
Erfragt wird zum einen die Perspektive der Unternehmen, die verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen: Ist der VSME-Entwurf aus ihrer Sicht ausreichend? Welche Informationen fehlen aus Sicht dieser berichtspflichtigen Unternehmen?
Zum anderen möchte EFRAG das Urteil der nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen kennenlernen: Ist der VSME-Entwurf für sie ausreichend, um Anfragen ihrer Geschäftspartner zu beantworten, und können die betroffenen Unternehmen die vom VSME geforderten Informationen erheben und angeben.
Die IHK Neubrandenburg ist an Ihrem Feedback interessiert und wird die Ergebnisse in das Beteiligungsverfahren der DIHK einbringen, die wiederum im Rahmen der EU-Konsultation Stellung nehmen wird.
Der für kapitalmarktorientierte KMU verbindliche “Listed SME-Standard (LSME)” wird die Vorgaben der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) festlegen. Ein Entwurf dieses im Auftrag der EU-Kommission von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelten Standards steht bis zum 21. Mai 2024 zur Konsultation. Ergänzende Informationen sowie der Fragebogen sind auf der EFRAG-Seite zu finden. Anmerkungen können mittels des Fragebogens auf der EFRAG-Seite (vgl. Link unten) eingereicht werden. Der LSME wird für die kapitalmarktorientierten Unternehmen verbindlich sein.
Nach der Konsultation durch EFRAG und ggf. einer Überarbeitung wird der LSME von der Kommission geprüft und ggf. nach einer weiteren Konsultation als delegierte Verordnung erlassen.
(Quelle DIHK)