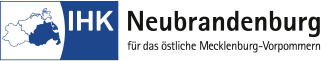Energieeffizienzgesetz - neue Pflichten für Unternehmen
DIHK-Webinar zum Energieeffizienzgesetz
Das Energieeffizienzgesetz hat Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Die DIHK hat dazu Berechnungen durchgeführt, diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.
Am 13. Oktober 2023 fand ein DIHK-Webinar zum neuen Energieeffizienzgesetz statt. Die Aufzeichnung finden Sie hier.
Das Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz (Energieeffizienzgesetz) ist am 18. November 2023 in Kraft getreten und legt Energieverbrauchseinsparziele für Bund, Länder sowie Kommunen fest. Darüber hinaus verpflichtet es Unternehmen zur Einführung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen, zu Energieeffizienzmaßnahmen sowie zur umfassenden Abwärmenutzung. Es enthält zahlreiche neue Berichts- und Offenlegungspflichten.
Nicht zuletzt auf Drängen der Wirtschaft hat die Regierungskoalition klargestellt, dass mit den allgemeinen Einsparzielen keine Begrenzung des individuellen Verbrauchs einhergehen soll und dass die Ziele bei "außergewöhnlichen und unerwarteten" konjunkturellen und Bevölkerungs-Entwicklungen angepasst werden können. Doch es droht erhebliche Rechtsunsicherheit: Werden Gerichte der Bundesregierung eine etwaige Zielverfehlung einfach durchgehen lassen? Und wenn nicht, drohen dann doch Limitierungen der Energieverbraucher durch die Hintertür?
Umwelt- und Energiemanagementsysteme in Unternehmen
Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtenergieverbrauch der letzten drei Jahre von mehr als 7,5 GWh müssen Energie- oder Umweltmanagementsysteme einführen und das spätestens bis 20 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes.
Sie müssen darüber hinaus:
- im Gesetz festgehaltene Kennzahlen dokumentieren
- technisch realisierbare Energieeinsparmaßnahmen und Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung identifizieren und darstellen
- eine Wirtschaftlichkeitsbewertung der identifizierten Maßnahmen nach DIN EN 17463 durchführen (Wirtschaftlichkeit gilt als gegeben, wenn Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Maßnahme nach DIN 17463 nach max. 50 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer einen positiven Kapitalwert ergibt.)
Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 2,5 GWh müssen für alle Einsparmaßnahmen aus Energie- und Umweltmanagementsystemen nach einschlägigen Gesetzen (EDL-G bzw. EnEfG) innerhalb von drei Jahren Umsetzungsplätze erstellen und veröffentlichen. Das BAFA prüft dies stichprobenartig. Auf Anfrage des BAFA ist die Umsetzung der Maßnahmen elektronisch nachzuweisen. Ausgenommen sind Anlagen nach § 4 BImSchG.
Wegen Unwirtschaftlichkeit nicht aufgenommene Maßnahmen müssen durch einen Zertifizierer/Umweltgutachter/Energieauditor bestätigt werden. Auf Anfrage des BAFA muss dies elektronisch bestätigt werden.
Einsparpflichten für den öffentlichen Sektor
Vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2030 soll der Bund durch von ihm erlassende Maßnahmen jährlich mindestens 45 TWh Endenergie bewirken (also nicht selbst einsparen, sondern durch Gesetze etc. „anreizen“). Jeder Sektor soll in angemessener Weise beitragen.
Die Länder sollen im gleichen Zeitraum mittels strategischer Maßnahmen jährlich mindestens 3 TWh einsparen.
Öffentliche Stellen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 1 GWh sollen bis zum Jahr 2045 jährlich 2 Prozent ihres Endenergieverbrauchs einsparen. Ausnahmen gelten für Forschungseinrichtungen, die an Lösungen wissenschaftlicher Problemstellungen arbeiten. Bei einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 3 GWh müssen Energie- und Umweltmanagementsysteme eingeführt werden.
Die Bundesstelle für Energieeffizienz bei der BAFA überwacht die Vorgaben, unterstützt die Länder und Kommunen bei der Erfüllung der Berichtspflichten, sowie das BMWK bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung im Bereich Energieeffizienz und baut eine Abwärmeplattform auf.
Pflichten für Rechenzentren
Betreiber von Rechenzentren müssen Energie- und Umweltmanagementsysteme einrichten; bei einer Nennanschlussleistung ab 1 MW (öffentliche Rechenzentren ab 300 kW) müssen sie diese ab 2026 zertifizieren lassen. Umfassende Daten zur Energieerzeugung, -verwendung und -effizienz sind zu veröffentlichen. Rechenzentren sind ab 2024 zu 50 Prozent und ab 2027 zu 100 Prozent bilanziell mit erneuerbarem Strom zu betreiben.
Regelungen zur Nutzung von Abwärme
Unternehmen müssen Abwärme nach dem Stand der Technik vermeiden und anfallende Abwärme auf technisch unvermeidbaren Teil reduzieren, soweit die möglich und zumutbar ist. Im Rahmen der Zumutbarkeit sind technische, wirtschaftliche und betriebliche Belange zu berücksichtigen. Anfallende Abwärme ist wiederzuverwenden, dabei sind auch Abnehmer auf dem Betriebsgelände und Dritte zu berücksichtigen. Ausgenommen von der Pflicht sind Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von weniger als 2,5 GWh.
Auf Anfrage müssen Unternehmen gegenüber Wärmenetzbetreibern, Fernwärmeversorgungsunternehmen potenziell wärmeabnehmenden Unternehmen Auskunft über technische Daten geben. Außerdem müssen sie der Bundesstelle für Energieeffizienz Auskunft über ein elektronisches Formular diese Angaben übermitteln, die in einem öffentlich einsehbaren Register bereitgestellt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sollen dabei gewahrt werden.
Strom- und Gaspreisbremse
Am 15. Dezember 2022 billigte der Deutsche Bundestag die Strom- und Gaspreisbremse, am 16. Dezember 2022 passierte das milliardenschwere Entlastungspaket auch den Bundesrat. Ebenfalls wurde für weitere Heizmittel ein Beschluss für einen Härtefallfonds geschaffen. Mit den Preisbremsen und den Härtefallhilfen sollen Unternehmen und Verbraucher für das Jahr 2023 entlastet und vor den krisenbedingten hohen Energiepreisen geschützt werden. Die Entlastungen wirken ab 1. Januar 2023 und sind zunächst für das gesamte Jahr 2023 vorgesehen. Eine Verlängerung bis zum 30. April 2024 ist geplant. Die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen werden mittels des wirtschaftlichen Abwehrschirms des Bundes finanziert, mit einem Volumen von insgesamt 200 Milliarden Euro. Durch eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen sollen Stromerzeugungsunternehmen an der Finanzierung beteiligt werden.
Gesetze und Informatioen des BMWK
Die Gesetzentwürfe sowie wichtige Ausführungen und ein FAQ des federführenden Ministeriums BMWK sind online abrufbar:
Das Gesetz zur Gas- und Wärmepreisbremse finden Sie hier.
Das Gesetz zur Strompreisbremse finden Sie hier.
FAQs und Informationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
Übersicht über die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen
Folgende Energiepreisentlastungen sind je nach Verbrauchsgruppe und Energieart ab 1. Januar 2023 im laufenden Jahr zu erwarten:

Webinar und weitere Informationen zu den Energiepreisbremsen
Der DIHK hat mit zwei Informationswebinaren am 20. und 21. Dezember 2022 über die Ausgestaltung der Strom- und Gaspreisbremsen informiert. Bei diesen Veranstaltungen stellte das Energie-Team des DIHK die wichtigsten Inhalte und Knackpunkte der beiden Gesetze vor. Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht Ihnen auf den Seiten des DIHK zur Verfügung.
Die Folien aus dem Webinar stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Alle wichtigen Informationen zur Gas-, Strom- und Wärmepreisbremse sowie ein FAQ des DIHK finden Sie hier.
Energieberatung
Neues Faktenpapier Wasserstoff veröffentlicht
Ob als Raketentreibstoff, Prozessgas in der Kraftstoffherstellung oder als Grundelement in Düngemitteln - Wasserstoff hat bereits heute viele Einsatzbereiche. Im Energiesystem stellt Wasserstoff bisher dennoch eine eher untergeordnete Rolle dar. Das soll sich mit der Nationalen Wasserstoffstrategie ändern. Mit dem neuen Faktenpapier soll mehr Licht in die Diskussion um Wasserstoff(-Technologien) gebracht werden. In dem Faktenpapier beschreibt der DIHK die Kosten, Einsatzmöglichkeiten, Herstellungsarten sowie Chancen, aber auch Hemmnisse, beim Einsatz und der Herstellung von Wasserstoff. Außerdem wird ein Blick auf die Strategien anderer Länder geworfen, nachdem die Bundesregierung zwischenzeitlich die Nationale Wasserstoffstrategie veröffentlicht hat.
Das Faktenpapier steht Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung.
Da sich der Wissensstand laufend ändert, wird das Dokument kontinuierlich weiterentwickelt. Obwohl die Informationen zu diesem Papier sorgfältig recherchiert wurden, kann für die inhaltliche Richtigkeit vom DIHK keine Haftung übernommen werden. (Stand: Juni 2020)
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) - Merkblatt und CO2-Rechner
Im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung wurde das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) mit einer CO2-Bepreisung für fossile Brennstoffe wie Erdgas und Diesel beschlossen. Sie beginnt 2021 mit einem Preis von 25 Euro je Tonne CO2. Dieser Preis wird bis 2025 jährlich erhöht. Der eigentliche Emissionshandel beginnt 2026 mit einem Preiskorridor von 55-65 Euro pro Tonne CO2. Parallel zur Einführung der CO2-Bepreisung soll eine Reduzierung der EEG-Umlage erfolgen, diese ist aber gesetzlich noch nicht umgesetzt. Wie sich das Vorhaben in den kommenden Jahren auf die Energiekosten Ihres Unternehmens auswirkt, können Sie mit dem neuen CO2-Preisrechner der IHK-Organisation abschätzen.
Sie finden den Rechner hier.
Über die geplante Ausgestaltung des Brennstoffemissionshandels informiert ein Merkblatt des DIHK, welches ihnen im Downloadbereich zur Verfügung steht. Es erläutert unter anderem, wer Zertifikate kaufen muss, welche Brennstoffe unter den Zertifikatehandel fallen und wie das Verhältnis zum bereits bestehenden Europäischen Emissionshandel ist. Viele Details zur Ausgestaltung werden erst im Laufe der kommenden Monate beschlossen, daher wird das Merkblatt regelmäßig aktualisiert werden.
Markstammdatenregister gestartet
Nach mehreren Verschiebungen war es soweit: Das Marktstammdatenregister startete zum 31. Januar 2019. Für alle bereits bestehenden Lieferanten, Anlagen- und Speicherbetreiber gelten Übergangsvorschriften. Schnell registrieren müssen sich hingegen Akteure, die neue Anlagen in Betrieb nehmen und für die somit zum ersten Mal eine Registrierungspflicht greift.
Um das Register zum Start nicht zu überlasten, ist es ratsam, dass alle Registrierungen (Be-standsanlagen), die zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig sind, erstmal aufgeschoben werden.
Das Marktstammdatenregister finden Sie hier.
Das Marktstammdatenregister (MaStR) ist eine Onlineplattform und soll ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes werden, das von Behörden und den Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt werden kann. Verantwortlich für das Betreiben der Plattform ist die Bundesnetzagentur.
Mit dem Aufbau der neuen Plattform werden folgende Ziele verfolgt:
- Vereinfachung von behördlichen und privatwirtschaftlichen Meldungen
- Reduzierung der Zahl der Register, in denen Akteure und Anlagen gemeldet werden müssen. Das Anlagenregister für EE-Anlagen, die ab August 2014 in Betrieb gegangen sind, sowie das PV-Meldeportal, bei dem Betreiber ihre Solaranlagen melden müssen, werden durch das neue Register ersetzt.
- Steigerung der Datenqualität und der Transparenz. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten im MaStR trägt jeweils der Dateninhaber selbst die Verantwortung. Die Daten sind vom Dateninhaber einzutragen und jederzeit aktuell zu halten.
Wer muss welche Daten registrieren?
Zu registrieren sind alle Strom- und Gaserzeugungsanlagen, die mit dem Strom- oder Gasnetz direkt oder indirekt verknüpft sind oder sein können; Energieverbrauchsanlagen sind nur dann im MaStR zu registrieren, wenn sie an ein Stromhöchst- oder -hochspannungsnetz bzw. an ein Gasfernleitungsnetz angeschlossen sind. Zudem sind alle Akteure des Strom- und Gasmarktes zu registrieren; dies gilt auch für Letztverbraucher, deren Verbrauchsanlage an ein Höchst- oder Hochspannungsnetz oder an ein Fernleitungsnetz angeschlossen ist.
Registrierung als Voraussetzung für Marktprämien
Außerdem ist die Registrierung von EEG- und geförderten KWK-Anlagen Voraussetzung dafür, dass Marktprämien, Einspeisevergütungen und Flexibilitätsprämien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie Zuschlagszahlungen und sonstige finanzielle Förderungen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gezahlt werden.
Ins MaStR können ausschließlich Stammdaten eingetragen werden: u.a. Standorte, Kontaktinformationen, technische Anlagendaten, Unternehmensform, technische Zuordnung, Geodaten. Bewegungsdaten, die energiewirtschaftlichen Aktivitäten abbilden und betreffen, können im MaStR nicht eingetragen werden.
Geschlossene Verteilnetze
Im Marktstammdatenregister müssen sich alle Netzbetreiber registrieren - das gilt nach §3 Nr. 5 auch für die Betreiber geschlossener Verteilnetze. Die Bundesnetzagentur wird eine Vorregistrierung vornehmen und mit den Netzbetreibern Kontakt aufnehmen. Sollten Unternehmen ein geschlossenes Verteilnetz betreiben und nicht im Laufe des Monats Mai von der Bundesnetzagentur kontaktiert werden, empfiehlt der DIHK mit dem Marktstammdatenregister Kontakt aufzunehmen (mastr(at)BNetzA(dot)DE). Die vollständige und abschließende Registrierung endet am 1. Juli mit dem offiziellen Start des Registers.
Bestandsanlagen
Die Betreiber der Bestandsanlagen werden verpflichtet sein, sich selbst als Marktakteur im MaStR neu zu registrieren, ihre Bestandsanlagen im MaStR-Datenbestand zu suchen und die die Daten zu ergänzen bzw. zu korrigieren. Sie müssen abschließend die Datenverantwortung übernehmen.
Für die Erfüllung dieser Pflichten wird eine Übergangsfrist von zwei Jahren bis zum 31. Januar 2021 eingeräumt.
Bitte beachten Sie, dass bereits zwischen 1. Juli 2017 und 31. Januar 2019 registrierte EEG- und KWK-Anlagen in Betrieb zwar als registriert gelten, fehlende Daten jedoch im Webportal nachgetragen werden müssen. Hierzu ist eine Anmeldung auf www.marktstammdatenregister.de und eine erneute Eintragung aller Betreiber- und Anlagendaten notwendig!
DIHK-Merkblatt zum Marktstammdatenregister
Zahlreiche Informationen rund um das Marktstammdatenregister und die neuen Registrierungspflichten finden Sie im DIHK-Merkblatt, welches Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung steht.
Detaillierte Informationen zum Marktstammdatenregister, samt Rechtsgrundlagen und Gesamtkonzept stehen Ihnen auch auf der Homepage der Bundesnetzagentur zur Verfügung.
Der IHK-Strompreis-Umlagen-Rechner im Internet ist aktualisiert worden. Damit können Unternehmen und private Verbraucher selbst errechnen, wie viel sie 2022 für die Umlagen für Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, Offshore-Haftung, abschaltbare Lasten und atypische Netznutzung zahlen müssen. Insgesamt sinkt die Umlagenbelastung 2022. So reduziert sich bspw. die EEG-Umlage auf 3,723 Cent/kWh (2021: 6,50 Cent/kWh).
Für die Berechnung der eigenen Belastung muss nur der Jahresstromverbrauch in den IHK-Rechner eingegeben werden. Mit der Eingabe des Stromkostenanteils am Umsatz können Unternehmen des produzierenden Gewerbes prüfen, ob Ermäßigungen möglich sind und wie hoch diese ausfallen. Der aktualisierte Strompreis-Umlagen-Rechner, den die Kollegen der IHK Lippe zu Detmold entwickelt haben, berücksichtigt die Fallgestaltungen der Besonderen Ausgleichsregelung des aktuellen Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Für die korrekte Berechnung ist die Eingabe der Stromkostenintensität und in Einzelfällen der Bruttowertschöpfung erforderlich.
Zum IHK-Strompreis-Umlagen-Rechner gelangen Sie hier.
Energie- und Stromsteuer: Berechnungstool
Neben dem IHK-Merkblatt steht auch ein Berechnungstool zur Energie- und Stromsteuer zur Verfügung. Das von der IHK Lippe zu Detmold erarbeitete Tool stellt Ihnen Excel-Tabellenblätter für das Antragsjahr 2020/2021 zur Verfügung.
Das Berechnungstool wurde von der IHK Lippe zu Detmold bereits kurz nach der Einführung der ökologischen Steuerreform entwickelt und wird seitdem an die Rechtslage angepasst. Das Excel-Berechnungstool berechnet die möglichen Erstattungsansprüche nach den §§ 51 bis 55 Energiesteuergesetz bzw. §§ 9 bis 10 Stromsteuergesetz und umfasst die aktuelle Rechtslage.
Hier gelangen Sie zum Berechnungstool der IHK Lippe zu Detmold.
Zum Jahresbeginn 2020 wurde das Faktenpapier Stromhandel und Strombeschaffung aktualisiert. Das Faktenpapier wurde gemeinsam vom DIHK und Efet Deutschland (Verband Deutscher Energiehändler e.V.) erarbeitet und bietet einen Überblick rund um die Themenfelder Stromhandel und Strombeschaffung. Zudem werden bestehende Herausforderungen aufgegriffen und entsprechende Hinweise gegeben. Das Papier steht Ihnen zum Download zur Verfügung.
Unternehmen, die laut Definition der EU nicht als „klein“ oder „mittelgroß“ (KMU) gelten und weder ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 noch ein Umweltmanagementsystem nach EMAS vorhalten, müssen bis zum 5. Dezember 2015 ein Energieaudit durchgeführt haben. Es muss dann mindestens alle vier Jahre wiederholt werden. Die Verpflichtung ergibt sich aus der Novelle des Energiedienstleistungs-Gesetzes als nationale Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie.
Wer ist betroffen?
Jedes Unternehmen sollte für sich prüfen, ob die KMU-Kriterien tatsächlich zutreffen. „KMU“ steht für „kleine und mittlere Unternehmen“. Laut EU-Begriffsbestimmung sind für die Einstufung zwei Faktoren ausschlaggebend: die Zahl der Mitarbeiter sowie der Umsatz oder die Bilanzsumme. Als „groß“ gelten Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern sowie einem Umsatz von mehr als 50 Mio. oder einer Bilanzsumme von 43 Mio. Euro. Keine „KMU“ sind unabhängig von Größe und Umsatz definitionsgemäß auch alle Unternehmen, deren Kapital zu 25 Prozent oder mehr von der öffentlichen Hand gehalten wird.
Das produzierende Gewerbe war bisher im Rahmen der Vergünstigungen bei Energie- und Stromsteuer und der EEG-Umlage ohnehin in der Pflicht. Das neue Gesetz betrifft nun auch Handel, Banken, Versicherungen, Kliniken und insbesondere Unternehmensbeteiligungen sowie verbundene Unternehmen.
Wichtig!: Die individuelle Bewertung als KMU oder Nicht-KMU obliegt dem Unternehmen selbst. Über die konkrete Einordnung als eigenständiges Unternehmen, als Partnerunternehmen oder als verbundenes Unternehmen und die damit verbundenen Berechnungsverfahren für die Schwellenwertbestimmung gibt ein Benutzerhandbuch der EU zur KMU-Definition Auskunft.
Was ist ein Energieaudit?
Das Gesetz schreibt vor, dass ein Energieaudit gemäß den Vorgaben der DIN EN 16247-1 (Ausgabe Oktober 2012) aufzubauen ist. Laut dieser Norm bezieht sich ein Energieaudit immer auf eine systematische Inspektion und Analyse des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes, eines Systems oder einer Organisation. Ziel ist es, die Energieflüsse und das Potenzial für Energieeffizienzverbesserungen zu identifizieren und darüber zu berichten. Details erläutert ein Merkblatt des zuständigen Bundesamts für Ausfuhr (BAFA).
Wer kann ein Energieaudit durchführen?
Das BAFA hat eine Energieauditoren-Liste veröffentlicht. Diese Liste steht Ihnen hier zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Liste ständig erweitert wird.
Weiterhin gibt es ein Merkblatt zur Eintragung in dieseListe.
Die Zulassung als Energieauditor wird im EDL-G § 8b definiert:
Das Energieaudit ist von einer Person durchzuführen, die aufgrund ihrer Ausbildung oder beruflichen Qualifizierung und praktischen Erfahrung über die erforderliche Fachkunde zur ordnungsgemäßen Durchführung eines Energieaudits verfügt. Die Fachkunde erfordert:
1. Eine einschlägige Ausbildung, nachgewiesen durch
a) den Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums in einer einschlägigen Fachrichtung
oder
b) eine berufliche Qualifikation zum staatlich geprüften Techniker oder zur staatlich geprüften Technikerin in einer einschlägigen Fachrichtung oder einen Meisterabschluss oder gleichwertigen Weiterbildungsabschluss.
2. Eine mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit, bei der praxisbezogene Kenntnisse über die betriebliche Energieberatung erworben wurden.
Merkblatt des BAFA beachten!
Das BAFA wurde mit der stichprobenhaften Überprüfung der Energieaudits sowie der Bereitstellung einer öffentlichen Liste von Personen, die über die erforderliche Qualifikation verfügen, um ein Energieaudit im Sinne von § 8 des EDL-G durchzuführen, beauftragt. Informationen und Kontaktmöglichkeiten zum BAFA finden Sie hier.
Das BAFA hat zum Thema Energieaudits auch ein Merkblatt veröffentlicht, das vertiefte Informationen und Hinweise beinhaltet.
Als Teil der Energieeffizienzstrategie will die Bundesregierung bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie die bisherigen Förderprogramme neu geordnet, gebündelt und übersichtlicher gestaltet. Zum 1. Januar 2021 startete die neue „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“.
Welche Änderungen gibt es bei der energetischen Gebäudeförderung des Bundes seit 2021?
Die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien im Gebäudesektor wird erstmals unter einem Dach zusammengeführt und vereinfacht. Bei Neubauten und Komplettsanierungen ist der Einsatz erneuerbarer Energien zukünftig noch stärker prämiert. Gleichzeitig gibt es neue, attraktive Förderangebote für besonders ambitionierte Sanierungen und Neubauten. Weiterhin werden erstmals Nachhaltigkeitszertifikate in der investiven Förderung berücksichtigt. Die Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung wird ausgeweitet. Die Fördertatbestände werden zukünftig als Zuschuss- und als Kreditförderung angeboten. Das bedeutet mehr Flexibilität für die Antragsteller. Zugleich wird die Komplexität der Förderlandschaft und damit der bürokratische Aufwand reduziert: Das BEG ersetzt die bisherigen vier Förderprogramme „Energieeffizienz Bauen und Sanieren“, „Marktanreizprogramm – MAP“, „Anreizprogramm Energieeffizienz“ sowie das „Heizungsoptimierungsprogramm“. Zukünftig wird ein Antrag ausreichen, um sämtliche Förderangebote für den Gebäudesektor nutzen zu können.
Wie ist die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude aufgebaut?
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) besteht aus drei Teilprogrammen, die jeweils in der Zuschuss- und der Kreditvariante angeboten werden:
• Wohngebäude (BEG WG),
• Nichtwohngebäude (BEG NWG),
• Einzelmaßnahmen (BEG EM).
Die Zuschüsse für Einzelmaßnahmen sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. Die Kredit- und Zuschussvarianten für Wohn- und Nichtwohngebäude werden durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Zusammenarbeit mit den Hausbanken umgesetzt. Außerdem gibt es bei der KfW für Einzelmaßnahmen die Möglichkeit eines Kredites mit Tilgungszuschuss.
Zum 1. Januar 2021 startete die Zuschussförderung für Einzelmaßnahmen im Teilprogramm BEG EM durch das BAFA. Mit den Einzelmaßnahmen müssen keine (neuen) Effizienzhaus- oder Effizienzgebäudestufen erreicht werden. Gefördert werden Maßnahmen an der Gebäudehülle, der Anlagentechnik, erneuerbare Energien für Heizungen, Heizungsoptimierung sowie Fachplanung und Baubegleitung im Zusammenhang mit einer Einzelmaßnahme. Eine wichtige Neuerung betrifft auch die Einbindung von Energieeffizienz-Experten. Bei der Beantragung von Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und/oder
Anlagentechnik (außer Heizung) sowie bei Anträgen, in denen mehrere Wärmeerzeuger kombiniert werden, ist die Einbindung eines EnergieeffizienzExperten notwendig. Bei den anderen förderfähigen Maßnahmen erfolgt die Einbindung optional. Auch die Einbindung von Energieeffizienz-Experten ist mit bis zu 80 Prozent des Beratungshonorars förderfähig.
Zum 1. Juli 2021 sind zudem die Teilprogramme für Wohngebäude (BEG WG) und Nichtwohngebäude (BEG NWG) in Kraft getreten. Diese Programmteile werden durch die KfW betreut:
• Nichtwohngebäude – Kredit, Programmnummer 263
• Nichtwohngebäude – Zuschuss, Programmnummer 463
• Wohngebäude – Kredit, Programmnummern 261, 262
• Wohngebäude – Zuschuss, Programmnummer 261
In den Teilprogrammen der KfW gibt es die Möglichkeit der Zuschuss- oder Kreditförderung für den Neubau oder die Sanierung zum Effizienzhaus. Wenn mit der Sanierung keine Effizienzhausstufe angestrebt wird, werden auch Einzelmaßnahmen durch die KfW
durch einen Kredit mit Tilgungszuschuss (BEG EM Kredit) gefördert.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des BAFA und der KfW.
Der Emissionshandel ist im Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG) in deutsches Gesetz überführt worden. Daneben gelten zahlreiche Verordnungen. Diese Rechtsgrundlagen sowie alle wichtigen Informationen zur Antragstellung, Zuteilung und den Sachverständigen sind auf den Internetseiten der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) beim Umweltbundesamt zusammengestellt.
Dem Emissionshandel unterliegen danach große Energieanlagen und bestimmte Industrieanlagen (siehe Anhang 1 des TEHG). Die Teilnehmer des Emissionshandels legen einmal jährlich einen Emissionsbericht vor. Die Angaben der Anlagenbetreiber in den Zuteilungsanträgen sowie in den Emissionsberichten müssen durch sachverständige Stellen geprüft und bestätigt werden. Eine Liste der für diese Aufgaben zugelassenen Sachverständigen findet sich auf den Internetseiten der DEHSt.
Carbon Leakage:
Emissionszertifikate werden überwiegend versteigert. Ausnahmen bestehen für bestimmte Industrieunternehmen, die den in der sogenannten Carbon-Leakage-Liste der Europäischen Kommission aufgeführten Branchen zugehören.
Faktenpapier überarbeitet:
Das vorliegende Faktenpapier enthält umfangreiches Zahlenmaterial zum Emissionshandel: So werden im dritten Handelszeitraum von 2013 bis 2020 europaweit etwa 8,2 Milliarden Zertifikate versteigert. Daraus ergeben sich beim derzeitigen Preis von 5 Euro je Tonne Ersteigerungserlöse von etwa 41 Milliarden Euro. Diese fließen fast ausschließlich in die öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten. Diese hatten in der Vergangenheit jedoch mit deutlich höheren Preisen gerechnet und u.a. Klimaschutzprojekte initiiert, die von diesen Geldern finanziert werden sollten.
Die Politik überlegt jetzt, wie die Preise wieder erhöht werden könnten. Mit den Beschlüssen zum Backloading hat die EU zuletzt erstmals grundlegend in eine laufende Handelsperiode eingegriffen. Nun ist eine Strukturreform geplant und die Einführung einer Marktstabilitätsreserve vorgesehen.
Fest steht: Das Klimaschutzziel wird von den am Emissionshandel beteiligten Unternehmen immer erreicht, da die Menge der CO2-Emissionen durch eine EU-weite Obergrenze festgelegt wird.
Warum das so ist, wie der Emissionshandel ausgestaltet ist und welche Überlegungen die Politik genau hat, zeigt das Faktenpapier, welches Ihnen unter den Downloads zur Verfügung steht.
Mit In-Kraft-Treten der Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) wurde die stufenweise Einführung von Gebäudeenergieausweisen zur Pflicht. Hinweise zum Ausweis sowie zu möglichen Ausstellern finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat sowie auch bei der Deutschen Energieagentur (dena).